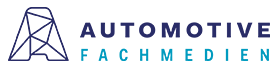Die Prophezeiung des E-Professors
Manfred Schrödl, Leiter des Institutes für Energiesysteme und Elektrische Antriebe an der TU Wien ist davon überzeugt, dass sich E-Autos bald endgültig durchsetzen werden.

KFZ WIRTSCHAFT: Herr Professor Schrödl, vor genau 10 Jahren haben wir ein Interview geführt, in dem Sie gemeint haben, die Elektromobilität stehe unmittelbar vor dem Durchbruch – hat sich Ihre Prophezeiung aus heutiger Sicht bewahrheitet?
MANFRED SCHRÖDL: Ja, auf jeden Fall. Betrachtet man die exponentiell steigende Kurve der Neuzulassungen, kann man den Beginn des Hochlaufs um das Jahr 2020 ansetzen. Vor allem in China hat sich die Elektromobilität seither aufgrund staatlicher Lenkungsmaßnahmen rasant verbreitet, aber auch in Europa zeigt die Kurve deutlich nach oben. In der Industrie herrscht heute bereits Konsens, dass sich der elektrische Antrieb durchsetzen wird, während Diesel und Benziner in Zukunft nur noch Nischen besetzen werden – wie übrigens auch Wasserstoff bzw. Brennstoffzellenautos, die wenig effizient, zu teuer und zu komplex sind, und zudem aufwändige Infrastruktur benötigen.
Welche Hürden muss die Elektromobilität noch nehmen, um den Verbrenner endgültig abzulösen?
Die Entscheidung trifft ausschließlich der Autokäufer, und für ihn zählt in erster Linie der Preis. Im Vergleich mit den tatsächlichen Kosten pro Kilometer sind Ideologien und Geschmäcker zweitrangig. Derzeit sind die Verbrenner zwar im Ankauf noch kostengünstiger, doch die Elektroautos werden immer erschwinglicher. Wenn bezahlbare Fahrzeuge im Bereich um 20.000 Euro eines Tages rund 500 Kilometer Reichweite und eine Ladedauer von 15 Minuten schaffen, wird der Verbrenner endgültig verloren haben.
Seit zehn Jahren hört man immer wieder von angeblichen Wunderbatterien, die bei niedrigeren Kosten mehr Kapazität, Ladekomfort und Sicherheit bieten sollen – wo stehen wir heute?
Tatsächlich ist der mehrfach angekündigte große Technologiesprung bisher ausgeblieben. Es gibt aber zwei Gebiete, auf denen derzeit vielversprechende Fortschritte erzielt werden. Zum einen sind das High Performance Stromspeicher, sogenannte Feststoffbatterien, bei denen ein fester keramischer Separator die bisher verwendeten flüssigen brennbaren Elektrolyte ersetzen wird – das wird sich vor allem in einer höheren Kapazität im gleichen Bauraum und geringeren Ladezeit bemerkbar machen. So hat beispielsweise das amerikanische Unternehmen Quantumscape, das eng mit dem VW-Konzern zusammenarbeitet, kürzlich einen Durchbruch bei der Serienfertigung der Keramikschichten gemeldet, und auch BYD hat angekündigt, noch vor 2030 eine Feststoffbatterie auf den Markt zu bringen. Die zweite vielversprechende Entwicklung findet bei den Medium-Performance Batterien statt, die Natrium statt Lithium verwenden. Ihre Performance liegt derzeit etwa auf dem Niveau von Lithium-Ionen Batterien vor zehn Jahren, die beispielsweise im BMW i3 oder VW e-Golf verbaut waren. Ihr Vorteil ist, dass sie bei geringen Herstellungskosten deutlich höhere Ladegeschwindigkeiten erlauben und auch viel weniger temperaturempfindlich sind als Lithium-Ionen Batterien. Meiner Ansicht nach wird sich diese Technologie in Fahrzeugen der 20.000 Euro Preisklasse spätestens 2030 etabliert haben.
Wie ist es um die Dauerhaltbarkeit der Batterien bestellt, bzw. wie viele Ladezyklen kann eine Fahrzeugbatterie absolvieren, bevor sie dramatisch an Kapazität verliert?
Die Erfahrung hat gezeigt, dass man die Lithium-Ionen Batterien in dieser Hinsicht stark unterschätzt hat. Ich selbst fahre seit 2016 einen Tesla Model X mit mittlerweile 260.000 Kilometern auf dem Tacho. Seine Batterie hat bis heute nur etwa 10 Prozent an Reichweite eingebüßt, und ich schätze, dass die Kapazität auch die nächsten 150.000 Kilometer noch durchaus brauchbar sein wird.
Geht der Ausbau der Infrastruktur aus Ihrer Sicht schnell genug voran, um mit der wachsenden Zahl an E-Autos mitzuhalten?
In Österreich und Deutschland sind wir auf einem guten Weg – da findet man im Durchschnitt etwa alle 30 Kilometer eine Ladesäule mit mindestens 50 kW. Meiner Meinung nach ist die Infrastruktur bereits gut genug ausgebaut, damit sich niemand fürchten muss, mit leerer Batterie liegen zu bleiben. Auf meiner Urlaubsfahrt von Wien an den Gardasee im heurigen Sommer lege ich einfach zwei Kaffee- und Ladepausen von je einer halben Stunde ein, das geht sich schön aus und man kommt entspannt am Ziel an.
Welche Chancen stecken in der Vehicle-2-Grid Technologie?
Das ist aus der Sicht des Elektrotechnikers die perfekte Technologie, um das Stromnetz zu stabilisieren und gleichzeitig die Ladeinfrastruktur sicher zu stellen. Wenn wir im Jahr 2040 von etwa zwei Millionen Elektroautos in Österreich ausgehen und rund ein Drittel davon als Strom-Zwischenspeicher zur Verfügung gestellt wird, könnten wir damit die österreichischen kurzfristigen Speicherkapazitäten zusätzlich zu den bestehenden Pumpspeichern massiv erhöhen. Technisch wäre das kein Problem, und die Fahrzeugbesitzer könnten beispielsweise durch vergünstigte Ladetarife und Vergütungen für ein netzdienliches Lade/Entladeverhalten davon profitieren. Eine höhere Hürde stellen aber noch die fehlenden Vereinbarungen mit den Netzbetreibern und Versicherungen dar. So müssen unter anderem die Gewährleistungsregeln für die Fahrzeugbatterien angepasst werden, wenn diese nicht nur während der Fahrten genutzt werden. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass Batterien bei oftmaliger schonender Ladung und Entladung mit geringer Leistung und Entladetiefe kaum an Lebensdauer einbüßen.
Wie wird die Elektromobilität aus Ihrer Sicht das Werkstattgeschäft verändern, bzw. welche Servicearbeiten und Reparaturen haben das Potenzial, den Wegfall des Verbrenner-Geschäftes zu ersetzen?
Schon heute zeigt sich, dass der Serviceaufwand für ein Elektroauto deutlich geringer ist als für einen Verbrenner. Ich fahre mit meinem Tesla eigentlich nur in die Werkstatt, wenn ich ein Pickerl brauche. In den letzten neun Jahren hatte ich nur einmal ein Problem mit dem Klimakompressor, und bei der Radaufhängung wurde ein Bauteil getauscht. Dafür fahre ich immer noch mit den ersten Bremsbelägen, weil ich hauptsächlich mit Rekuperation bremse. Meiner Einschätzung nach wird sich der Serviceaufwand durch die breite Einführung der Elektromobilität um insgesamt zwei Drittel verringern, darauf müssen sich die Werkstätten wohl einstellen. Ein mögliches Zusatzgeschäft für Werkstätten mit entsprechender Hochvolt-Infrastruktur und ausgebildetem Personal könnte dafür die Ermittlung des Gesundheitszustandes der Batterie bei Gebrauchtwagenkäufen werden.