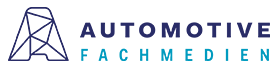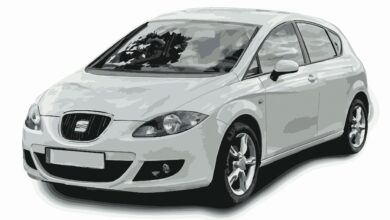Diagnosekrimi: Der falsche Verdacht
Eine junge Wienerin will mit ihrem Mercedes SLK eine Spritztour unternehmen, doch nach dem Drehen des Zündschlüssels beginnt der Motor zu stottern.

Das Mercedes SLK 200 Cabrio ist 13 Jahre alt, wird von einem 184 PS starken 1,8 Liter Benzinmotor mit angeschlossenem Automatikgetriebe angetrieben und hat bereits 142.000 Kilometer auf dem Tacho. Eines Tages startet der Motor mit starker Rauchentwicklung und kräftigem Ruckeln, nimmt einige Sekunden lang kein Gas an, läuft danach aber einwandfrei, als wäre nichts gewesen. Die junge Besitzerin hat das Cabrio kurz zuvor aus einer freien Werkstatt abgeholt, in die sie es zum Service gebracht hatte. Da mehrere Teile getauscht wurden und die Kundin schlampige Arbeit sowie einen Folgeschaden vermutet, sucht sie via Internet eine neue Werkstatt und kommt so zu Diagnosespezialist Yücel Sarp, der gemeinsam mit seinem Bruder Yüksel in Wien-Ottakring eine Kfz-Werkstatt für alle Marken betreibt. Aus der vorigen Werkstatt hat sie noch die Information mitgenommen, dass vermutlich die Hochdruckpumpe defekt ist und ebenfalls getauscht gehört. Sarp nimmt sich der Sache an und gerät in einen Diagnosekrimi, aus dem er schließlich eine Lehre fürs Leben zieht.
- Die Kundin bringt das Cabrio in die Werkstatt und erteilt den Auftrag, die Hochdruck-Einspritzpumpe zu tauschen.
- Kfz Meister Sarp meldet Bedenken an, da die beschriebenen Symptome seiner Erfahrung nach nicht zu einer defekten Einspritzpumpe passen, und diese auch sehr selten kaputt geht.
- Das Cabrio wird an ein Diagnosegerät angeschlossen, das jedoch keine Fehlermeldung anzeigt. Auch bei einer anschließenden Probefahrt zeigen sich keine auffälligen Symptome, der Motor des Mercedes läuft völlig problemlos, alle Kontrollleuchten bleiben dunkel.
- Die Kundin besteht trotzdem auf dem Austausch der Einspritzpumpe, den Kfz Meister Sarp schließlich auch durchführt.
- Bei einem Routinecheck der anderen Motorkomponenten stellt er fest, dass die Zündkerzen noch nie getauscht worden sind und sich nur sehr schwer herausdrehen lassen.
- Die Zündkerzen werden erneuert, das Kraftstoffsystem entlüftet. Ergebnis: Der Motor startet und läuft dank der neuen Zündkerzen ruhiger als zuvor, das Cabrio wird der Kundin als repariert und erprobt übergeben.
- Bereits am nächsten Tag meldet sich die Kundin bei der Werkstatt – das Ruckeln und Rauchen beim Kaltstart am Morgen sei schon wieder aufgetreten. Außerdem habe sie bemerkt, dass das Instrument der Kühltemperatur noch immer 80 Grad anzeigt, obwohl das Auto zuvor 12 Stunden gestanden ist.
- Die Vermutung der Kundin, dass vielleicht das Steuergerät nicht ordnungsgemäß zurückgesetzt worden ist, weist Sarp zurück, denn plötzlich kommt ihm eine Idee, wo der Fehler liegen könnte.
- Die Bemerkung mit der offensichtlich falschen Anzeige der Kühlmitteltemperatur hat den entscheidenden Hinweis auf einen möglicherweise defekten Sensor geliefert.
- Sarp bittet die Kundin erneut in die Werkstatt, tauscht den Kühlmitteltemperatursensor aus, und tatsächlich: Das Problem ist behoben und tritt auch in den folgenden Tagen und Wochen nicht mehr auf. Diagnosekrimi gelöst.
Erkenntnis:
Yücel Sarp gesteht freimütig ein, in diesem Fall einen Fehler gemacht zu haben. Er ist dem Wunsch der Kundin zu schnell nachgekommen, die Einspritzpumpe zu tauschen und hat dabei seiner Intuition misstraut. Fazit: Die Reparatur machte inklusive Ersatzteilkosten und 2,5 Stunden Montageaufwand rund 1.400 Euro aus und führte dennoch nicht zum gewünschten Ergebnis. Die Behebung der tatsächlichen Fehlerursache war schließlich mit Kosten von 9,50 Euro für den Kühlmitteltemperatursensor und einem Montageaufwand von 3 Minuten dagegen vergleichsweise viel kostengünstiger. Obwohl die Kundin die Hauptschuld auf sich nimmt, da sie den Austausch der Einspritzpumpe vehement eingefordert hatte, fühlt sich Sarp zumindest mitschuldig. Als erfahrener Diagnostiker hätte er seiner Intuition mehr vertrauen und längere Überlegungen anstellen müssen, welche Ursache das Ruckeln und Rauchen des Motors beim Kaltstart haben könnte. Für die Zukunft habe er daraus gelernt, so Sarp, dass er die Rahmenumstände sowie die Vorgeschichte eines Defektes noch genauer als bisher unter die Lupe nehmen werde.